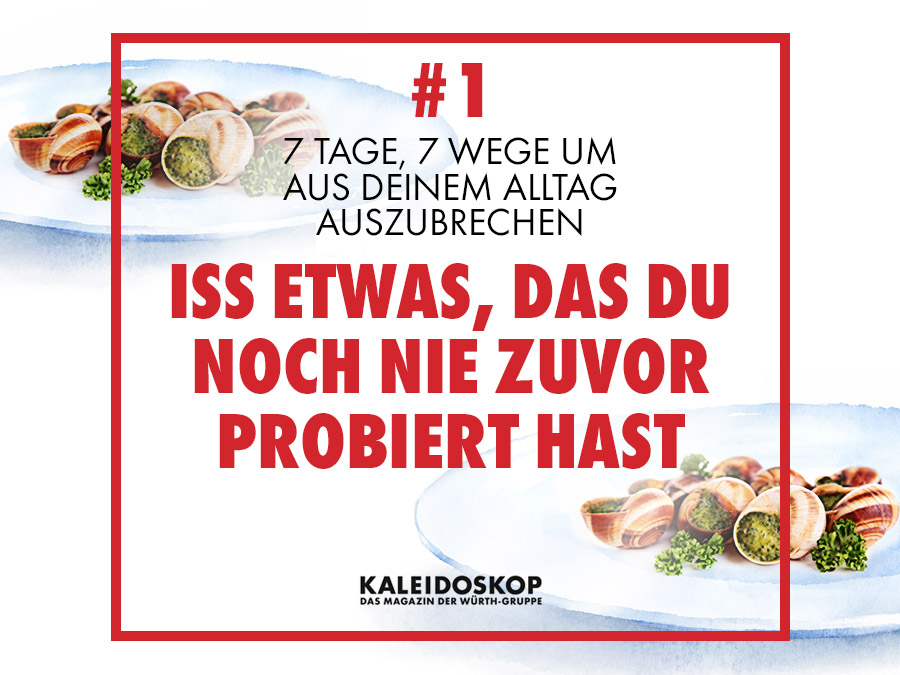Eines Tages ist es so weit. Man hat sich eine Routine für das eigene Leben zurechtgelegt. Man weiß, wie man den Menschen, mit dem man Bett und Tisch teilt, verärgern, wieder besänftigen und sogar entzücken kann. Man isst am liebsten italienisch und nur in Ausnahmefällen chinesisch. Man hört nicht mehr Radio, sondern nur noch die Lieder, die man schon kennt. Von denen weiß man, dass sie einem gefallen.
Das ist schön. Weil man merkt, wie sehr man in seinem eigenen Leben angekommen ist. Aber es ist auch gefährlich. Weil es jetzt so weitergehen wird, mit großer Wahrscheinlichkeit ziemlich lange. Nur noch selten Wunder, die einen umwerfen, knallwach machen, das Herz stolpern lassen.
ROUTINE IST GROSSARTIG, MAN KANN OHNE SIE NICHT LEBEN. DOCH NUR VON ROUTINE ZU LEBEN, HÄLT AUCH KEINER EWIG AUS.
Mittlerweile ist hinlänglich untersucht worden, wie schädlich das ist. Menschen, die sich nur noch auf den Schienen bewegen, von denen sie wissen, dass sie sie ans Ziel bringen, glauben irgendwann, dass es überall so zugeht wie in ihren eigenen Filterblasen. Und sie bleiben immer wieder unter ihren eigenen Möglichkeiten, da ihnen kaum noch etwas zustößt, woran sie wachsen könnten. Das ist bedauernswert für die Welt. Sie könnte es gut gebrauchen, dass ihre Bewohner sich miteinander auseinandersetzen, statt nebeneinanderher zu leben. Noch bedauernswerter ist das für einen selbst. Denn das Leben würde sofort sehr viel glühender und spannender werden, sobald man es hin und wieder einem Reizklima aussetzt.
TIPP: EINEN 16-JÄHRIGEN FRAGEN, WELCHE MUSIK ER MAG UND SIE DANN AUFMERKSAM ANHÖREN.
Man sollte also über den Tellerrand hinaussehen, ganz wörtlich. Den Lunch nicht immer in dem Restaurant nehmen, in dem man namentlich begrüßt wird, sondern im fünftnächsten drei Straßen weiter, selbst wenn es dort nur vegane Burger oder höllisch scharfe Currys geben sollte. Mit dem Menschen, mit dem man Tisch und Bett teilt, den Platz im Bett und am Tisch wechseln, um Perspektivwechsel zu schaffen. Einen 16-Jährigen fragen, welche Musik er mag und sie dann aufmerksam anhören. Auf anderen Wegen zur Arbeit gehen als bisher, mit Kollegen reden, von denen man bisher nicht viel mehr wusste, als dass es sie gibt. Sich in eine Kirche setzen, selbst wenn man nicht gläubig ist. Oder Konzerte besuchen, bei denen man Hallenältester ist.
Das sind lauter minimal invasive Maßnahmen, für die man sich nicht besonders überwinden muss. Wenn es gut geht, erfährt man durch sie, dass das Leben viel reicher ist, als man es sich bisher gegönnt hat. Falls nicht, lernt man immerhin, dass es genauso, wie man sich eingerichtet hat, perfekt ist. Das gelegentlich bestätigt zu bekommen, macht auch glücklich.
DURCHBRICH DEINE ROUTINE MIT DIESEN EINFACHEN TIPPS:
PETER PRASCHL
Peter Praschl, 1959 in Linz in Österreich geboren, lebt seit 1988 in Deutschland. Er schreibt als Autor für die „Welt am Sonntag“ für die Rubrik Kultur sowie als Kolumnist für „GQ“ (Kochen). Besonders zu empfehlen ist sein Beitrag über’s Essen zur Geisterstunde. Außerdem schreibt er für „Nido“ (Kinder) und die Filmzeitschrift „Cargo“ (Videos, die sich außer ihm niemand ansieht). Praschl lebt mit seiner Frau und zwei Töchtern in Berlin.

BITTE WENDEN: UNSERE GUIDES ZUM GLÜCK
Anders, besser vor allem aber bewusster leben. Unsere Gastautoren wagen das Experiment, hinterfragen Trends und geben inspirierende Tipps:
Ronja von Rönne über “Digital Detox”
Susanne Kaloff: “Hilfe, ich habe eine Gleichgewichtsstörung!”